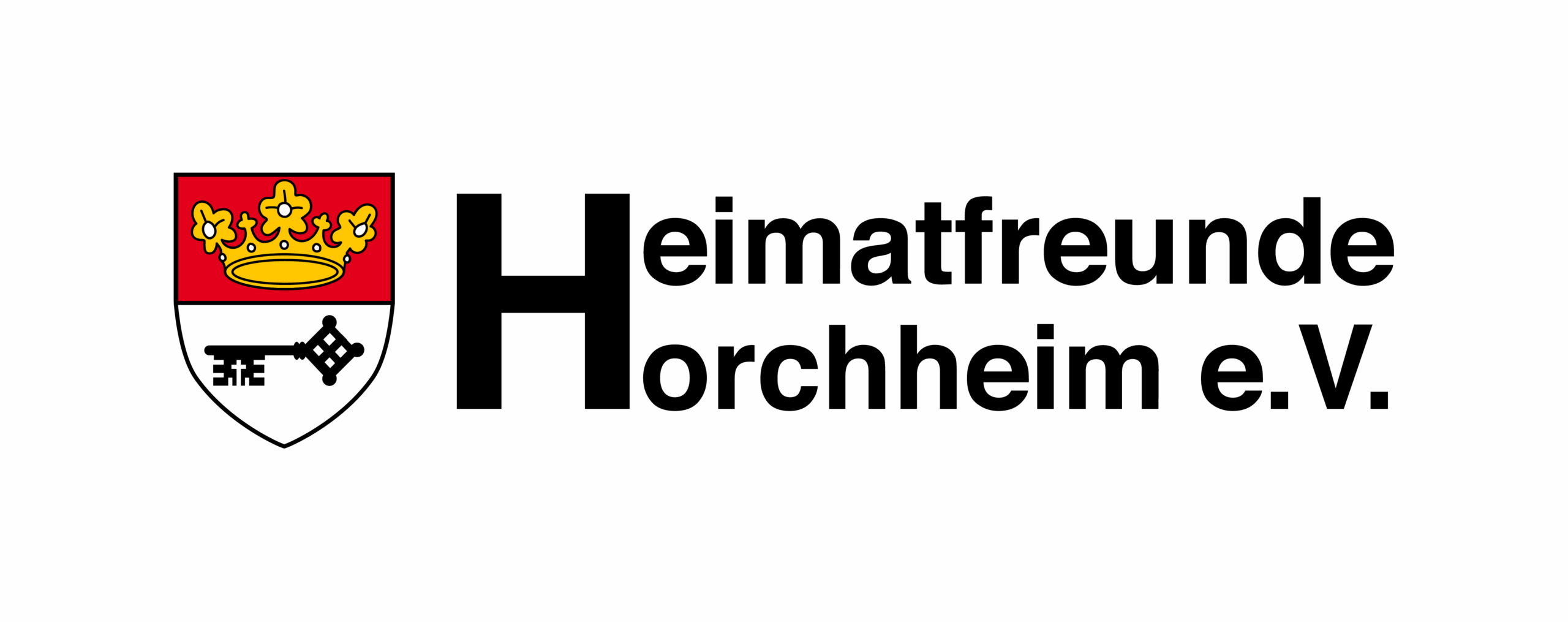Entnommen aus: Gerhard Caspers – SPUR DURCH DIE ZEIT – Erinnerungen I – Frühe Jahre
SCHULE IN HORCHHEIM
Im Frühjahr 1932 erzählte ich jedem, der es hören wollte, voller Stolz, ich käme an Ostern in die Schule. Ich freute mich wirklich. Als es so weit war, und ich eines morgens auf dem Schulhof stand, fühlte ich mich etwas beklommen. Ich hielt Vaters Hand so fest, daß die Ruhe, die von ihm ausging, langsam auf mein heftig klopfendes Herz einwirkte. Ich begann wahrzunehmen, was um mich her vorging.
Eine solche Beklommenheit hatte ich kurz zuvor erfahren, als ich ins Krankenhaus mußte. Unser Hausarzt, Dr. Walter Holler hatte zu einer Mandeloperation geraten, weil ich häufiger Beschwerden damit hatte. „Du fehlst sonst zu oft in der Schule“, tröstete er mich, Auf der Fahrt in seinem Auto nach Niederlahnstein, Vater fuhr mit, beeindruckte mich das seltene Erlebnis des Autofahrens zwar sehr, aber die Angst vor dem Ungewissen blieb unangenehm als Druck in meiner Brust. Ich weiß nicht mehr, wie es dann weiterging. Beim Erwachen aus der Narkose sah ich Vater neben meinem Bett sitzen. Ich klagte über Schmerzen im Hals. Er streichelte mich und sagte, ich müsse das aushalten, es werde schon am Abend besser sein. Dann erzählte er mir, daß das Mädchen im Bett daneben „den Bauch aufgeschnitten bekam“ wegen einer Blinddarmoperation.
Das Kind, wenig älter als ich, war auch Horchheimerin. Den Namen habe ich vergessen. Nach dem Krieg trat sie in den Orden der Armen Dienstmägde Jesu Christi in Dernbach ein. Hier muß ich eine kleine lustige Erinnerung einfügen. Irgendwann nach dem „Ewigen Gelübde“ dieses Mädchens unterhielten sich, bei einer Veranstaltung der Pfarrei, einige „fromme“ Frauen in übertriebener Ehrfurcht über die „ehrwürdige Schwester“. Auf die von mir bejahte Frage, ob ich sie kenne, wurde dann nach dem woher geforscht. „Mit der habe ich schon geschlafen“, sagte ich. Die Damen fielen fast in Ohnmacht. Sie beruhigten sich aber, als ich nachschob, es sei auf der Kinderstation des Krankenhauses gewesen.
Aus diesem bisher einzigen Krankenhausaufenthalt blieb ein für mich damals befremdliches Geschehen bei mir haften. Es war am dritten Tag, an dem ich nach Hause entlassen werden sollte. Auf Geheiß der Stationsschwester verließ ich das Bett, um mich anzukleiden. Als ich die Schlafanzughose gerade ausziehen wollte, stürzte die Schwester mit dem schrillen Aufschrei: „Nicht doch, nicht doch“ auf mich zu, um mir ein Handtuch um die Hüften zu schlingen. Vorwurfsvoll und strengen Blickes fragte sie, ob ich mich denn gar nicht schäme. Ich verstand überhaupt nicht. Sie zog mir unter dem Handtuch, das ihr Seelenheil und die Moral der anderen Kinder im Krankenzimmer schützen sollte, die Hose herunter. Dann folgte mit komplizierter Fummelei das Anziehen der Unterhose. Erst dann nahm sie das blöde Tuch weg. Ich durfte mich anziehen. Kurz darauf holten mich Eltern und Geschwister aus diesem manichäischen Irrenhaus ab. Daheim war Nacktheit so natürlich, daß es mir überhaupt nicht auffiel. In den Augen dieser Nonne war das sicher ein Sündenpfuhl.
Ich fing meine Gedanken wieder ein, betrachtete das Schulgebäude. Ich weiß nicht, ob es wegen des Schulbeginns oder aus einem anderen Anlaß beflaggt war. Eine schwarz-weiß-rote Fahne, für mich die deutsche, und die schwarz-weiße Preußens flatterten lustig im Wind. Die erstgenannten Farben kannte ich gut. Ich hatte sie schon oft bei den verschiedensten Gelegenheiten an unserem und an anderen Häusern gesehen. Auch die preußische war mir in Koblenz, der Hauptstadt der preußischen Rheinprovinz, nicht unbekannt geblieben. Einmal hatte ich in der Stadt eine Fahne gesehen, die mir unbekannt war. Sie war schwarz-rot-gold gestreift. Auf meine Frage, welchem Land die gehöre, erhielt ich Vaters Auskunft, das sei die offizielle Staatsflagge. Das machte sie mir nicht vertrauter. So ging es sicher auch den meisten Bürgern. „Die Republik (…) besitzt keine Nationalflagge, sondern nur eine durch behördliche Verfügungen und gesetzliche Bestimmungen eingeführte und bewachte Musterschutzmarke. Dieses (…) Symbol wird daher unserem Volke immer innerlich fremd bleiben.“ So hatte Hitler gespottet, (Mein Kampf, Seite 640). Leider hatte er, was das „innerlich fremd bleiben“ anging, nur sehr recht.
Ganz gleich, ob aus staatlichem Anlaß, oder weil Kirmes oder Fronleichnam, es wurde damals schwarz-weiß-rot geflaggt. Noch am Tag meiner Erstkommunion 1935 wehte die Fahne des Deutschen Kaiserreiches nicht nur von dem Mast im Vorgarten meines bürgerlichen Elternhauses. Auch die Häuser, in denen Jungen und Mädchen wohnten, die mit mir zusammen in der Klasse waren und den gleichen Festtag begingen, zeigten diese Farben. Es machte keinen Unterschied, ob die Väter dieser Kameraden Eisenbahner, Handwerker, Arbeiter, Akademiker oder Bauern waren. Dem kindlichen Verstehen noch gar nicht erkennbar, ereignete sich hier Geschichte in einer Richtung, die nach dem Untergang der Weimarer Republik manchen fragen ließ, warum sie so wenig Eingang fand in die Herzen der Menschen. Der erste Schultag war schon ein Lehrstück.
Zurück auf den Schulhof und zum dreiflügeligen Bruchsteinbauwerk, das die Gemeinde mit einer an der Außenwand angebrachten Tafel „Unseren Kindern“ widmete. Zwei Flügel beherbergten die acht klassige katholische Volksschule, einer die zweiklassige evangelische. An einem Fenster des Klassenraumes des achten Schuljahrganges hing außen eine kleine Glocke. An diesem Tag hörte ich zum ersten Mal ihr Gebimmel. Während sich die bis dahin auf dem Hof herumtobenden Kinder und die Eltern mit den Schulneulingen in Richtung auf die Klassenzimmer in Bewegung setzten, betrachtete ich mit Bewunderung den „großen“ Jungen, der oben am Fenster im ersten Stock die wichtige Funktion des Glöckners ausüben durfte.
Im Raum des ersten Schuljahres, Erdgeschoß rechts, herrschte ein fürchterliches Gedränge. Kein Wunder, denn die Klasse bestand aus siebenundzwanzig Jungen und einunddreißig Mädchen. Dazu kamen noch viele Eltern. Vor lauter Erwachsenen um mich herum konnte ich, außer ein paar unbekannten Kindern, denen es ebenso ging, nichts sehen. Ich hörte eine männliche Stimme, die die Namen der Kinder aufrief. Es war der Schulleiter, Rektor Diesler. Er war zum Nachfolger des pensionierten Alban Holl ernannt worden. Mit gespitzten Ohren paßte ich auf, um meinen Namen ja nicht zu verpassen. Was hörte ich? „Gertrud Caspers“. Das war ich nicht. Ich hatte keine Zeit zum Überlegen. Da hörte ich Vaters Einwand: „Nicht Gertrud, Gerhard“. Ohne mich in Augenschein zu nehmen, wurde ich durch den Rektor als Junge anerkannt. Ich fand in der zweiten Bankreihe an der Fensterseite meinen Platz.
An die Tafel hatte die Klassenlehrerin, Fräulein Albers, mit bunter Kreide ein Osterhasenbild gemalt. Es beeindruckte mich so, daß ich es aus der Erinnerung nachzumalen versuchte, als wieder Ostern war und wir dazu ein Bild malen sollten. Die Lehrerin, sie wurde am Ende des Schuljahres an eine andere Schule versetzt, blieb mir als lieb und mütterlich in Erinnerung. Im Lauf des Vormittags wurde jedes Kind draußen auf dem Schulhof fotografiert, den Ranzen auf dem Rücken, eine Tafel in den Händen, auf die jemand geschrieben hatte: Mein erstes Schuljahr 1932. In der Klasse wurden wir alle zusammen im Bild festgehalten. Ich besitze noch eine weitere Aufnahme von diesem denkwürdigen Tag. Vater machte sie, als ich Hand in Hand mit Dorchen Brühl, einem Nachbarskind, vor dem Elternhaus eintraf.
Es gefiel mir ganz gut in der Schule, wenn auch mein unglückliches Gesicht auf dem oben erwähnten Einzelbild anderes auszusagen scheint. Den jüngeren Schwestern gegenüber hatte ich wohl ein deutliches Überlegenheitsgefühl. Trotzdem fand ich es nett, wenn meine Schwester Brigitte, damals wie heute voll liebevoller Zuneigung zu ihrem Bruder, mir manchmal auf dem Heimweg ein Stück entgegenkam. Sie wollte meinen Schulranzen tragen. Das Abholen war sicher Liebe, das Ranzentragen unbewußte eigene Aufwertung für das kleine Mädchen, das sich dann zwischen den anderen Kindern „schon groß“ vorkam. Einmal habe ich ihr in der Straßenbahn, zur Freude aller Fahrgäste, einen Vortrag gehalten. Wir kamen mit den Eltern aus Koblenz. Im Wagen saß, als wir einstiegen, meine Lehrerin. Da neben ihr ein Platz frei war, setzte ich mich zu ihr. Brigitte saß etwas weiter weg, so daß ich mich ihr, etwas lauter sprechend, zuwandte: „Du, das hier ist meine Lehrerin. Du hast noch keine, bist noch zu klein. Nächstes Jahr bist du größer, dann darfst du auch in die Schule und bekommst eine Lehrerin. Nach einer kurzen Pause sagte ich: „Aber so nett wie meine ist die nicht!“ Die Leute lachten. Meine aufsteigende Verlegenheit klang gleich wieder ab, weil Fräulein Albers mir im rechten Augenblick lachend und verständnisvoll über den Kopf streichelte.
Hier muß ich nun über die Erfahrung berichten, die ich [auf Seite 7] bereits erwähnte. Das neue soziale Gebilde, die Schulklasse, gebar aus sich heraus die Auseinandersetzungen um die Freundschaften und Machtpositionen der Kinder untereinander. Dieser Vorgang, den man heute Gruppenprozess nennt, – manche sprechen mit Blick auf den Hühnerhof von Hackordnung und damit unter Vernachlässigung des psychisch-intellektuellen-humanen Aspektes nur vom „machtpolitischen“ Teil des Problems, – sah mich in einer schlechten Ausgangsposition. Ursache hierfür war nicht meine Erziehung, sondern der Umstand, daß es im Umkreis meines Elternhauses keine Jungen meines Alters gab, mit denen ich mich in diese Auseinandersetzungen hätte einüben können. Ich hatte auch wenig Erfahrung in handgreiflichen Kraftproben, wie sie unter Kindern, besonders unter Jungen, zur Entwicklung gehören. Das wäre alles nicht so schlimm gewesen, hätte sich wohl auch im Laufe der Zeit ausgewachsen, wäre da nicht ein Klassenkamerad, Karl Zehe, gewesen. Aus mir unbekannten Gründen begann er nach einigen Wochen in der Schule, mich zu schikanieren, wo er nur konnte. Er prügelte sich mit anderen auch, und er genoß den Ruf, sehr stark zu sein, obwohl er nicht so aussah. Unerfahren, wie ich in solchen Dingen war, aber sicher auch aus Feigheit unterließ ich es, ihm die Grenzen zu zeigen, die er nicht ungestraft überschreiten durfte. Hier spielte sicher auch die zwar gut gemeinte, aber welt- und wirklichkeitsfremde, aus der Harmonievorstellung meiner Mutter geborene Maxime „Kinderchen vertragt euch“ hinein.
Nun ist es Menschen und Mächten mit aggressiver Struktur eigen, Nachgiebigkeit und Feigheit der Gegenseite zum Ausbau der eigenen Position rücksichtslos auszunutzen. So auch Karl Zehe. Er begann, mich in der Pause, dann auf dem Heimweg zu verprügeln, weil ich auf die vorhergehende Stufe des Anrempelns nicht angemessen reagiert hatte. Ich beklagte mich bei meinem Vater. Heimlich hatte ich die Hoffnung, Vater würde dem Karl „Bescheid sagen“, oder dessen Eltern ansprechen. Es kam ganz anders. Vater erklärte mir, daß ich diese Sache selbst durchstehen müsse, im konkreten Fall, ich müsse mich wehren. Außerdem sei es wahrscheinlich, daß Karl seine Position viel mehr der Feigheit der anderen, als eigener Kraft verdanke. Er könne verstehen, daß ich Angst hätte, das sei alleine nicht schlimm. Schlimm sei nur, wenn ich mich davon unterkriegen ließe. Vater schärfte mir ein, ich solle niemanden angreifen, schon gar nicht Schwächere, aber ich solle auch nicht kuschen vor den Drohungen Streitsüchtiger. Es gab noch ein paar taktische Hinweise, eine liebevolle Umarmung und den Schlußsatz: „Du kannst das schaffen!“
Am nächsten Tag stellte Karl mich nach Schulschluß in dem kleinen Verbindungsweg vom Schulhof zum Römerplatz. Als ich ihn sah, war da wieder die Angst. Er griff mir an die Brust, versuchte, mich herumzuschütteln. Da schlug ich zu. Meine Faust traf ihn mitten ins Gesicht. Karl muß so überrascht gewesen sein, daß er für Sekunden regungslos da stand. Er ließ mich nicht los. Da traf ihn mein zweiter Schlag schräg am Kinn. Krachend ging er zu Boden. Ich warf meinen Ranzen weg, stürzte mich auf ihn und schlug auf ihn ein, so lange er sich wehrte. „Aufhören, aufhören“, winselte er. Seine Lippen und Nase bluteten. Kameraden rissen mich hoch, feierten mich als Sieger. Sie hoben meinen Ranzen auf, klopften mir die Kleidung ab. Es war ein Triumph, es war mein Sieg. Mein Sieg über Karl, wichtiger noch, mein Sieg über meine Angst. An diesem Tag habe ich gelernt, daß Angst durch Tapferkeit besiegbar ist. Karl hatte zwei Wochen lang ein blaues Auge, ich in den vier Jahren in der Volksschule keine Schlägerei mehr mit Klassenkameraden. Manche, die mich bisher nicht beachtet hatten, interessierten sich jetzt für mich, spielten mit mir. In kameradschaftlicher Hinsicht verliefen die Volksschuljahre in erfreulicher Harmonie. Wichtig war mir die Erkenntnis, daß Vaters Ratschläge realisierbar waren, Mutters Theorien nicht.
Im zweiten Schuljahr, also ab Ostern 1933, bekamen wir nicht nur ein anderes Klassenzimmer, das links vom Haupteingang gelegene, wir bekamen auch eine neue Lehrerin, Fräulein Therese Hartmann. Sie stammte aus Ehrenbreitstein, aus der Kohlenhandlung gleichen Namens, die ihr Bruder betrieb. Ihr Elternhaus, der ehemalige Junkerhof, steht heute noch an der Charlottenstraße nahe dem ehemaligen Amtsgericht. Fräulein Hartmann war, wie damals wohl die meisten Lehrerinnen, unverheiratet. Ob das statistisch bewiesen ist, weiß ich nicht, ich habe aber in meiner ganzen Schulzeit, sowohl in der Volksschule, als auch im Gymnasium nur unverheiratete Lehrerinnen erlebt. Sie wohnte zusammen mit einer ebenfalls unverheirateten Schwester, die ihr den Haushalt führte, in der Emserstraße, gegenüber dem Mendelssohnpark.
Wenn ich mich dieser Lehrerin erinnere, zu deren Klasse ich vom zweiten bis zum Ende des vierten Schuljahres gehörte, also drei Jahre lang, fällt mir zuerst ein, daß ich sie mit kindlicher Zuneigung verehrte, vielleicht sogar liebte. Meinen Schulkameraden und -kameradinnen ging es, so nehme ich an, zumindest in der Unterstufe ebenso. Das heißt nun nicht, daß immer alles voller Harmonie war. Die Volksschullehrer jener Zeit hatten eine, in diesem Umfang nicht mehr gegebene Möglichkeit, prägend auf die Kinder und den Geist der Klasse einzuwirken. Sie waren ja, in allen Fächern unterrichtend, – nur Religion gab manchmal der Pastor, – Tag für Tag mit „ihren“ Kindern zusammen. Das gab beiden Seiten die Möglichkeit, sich auf einander einzustellen. Selbstverständlich hat eine solche Methode auch bedenkenswerte Schattenseiten. Mir hat jedenfalls diese Vertrautheit ein Schulklima vermittelt, in dem es sich als Kind ohne den heute viel besprochenen Schulstreß glücklich leben ließ. Wie sehr mir diese Vertrautheit behagte, erhellt vielleicht auch daraus, daß ich später, nach dem Übergang auf das Gymnasium, zunächst nichts als so starke Veränderung empfand, als den stündlichen Wechsel der Lehrkräfte.
Zum pädagogischen Handwerkszeug damaliger Lehrer gehörte auch noch der Stock. „Prügelstrafe“, förmlich höre ich den entrüsteten Aufschrei „moderner“ Lehrer. Nun, ich bin auch nicht dafür, den Stock als ultima ratio wieder einzuführen. Mir stellt sich aber die Frage, ob der Psychoterror des Leistungsdrucks, von Lehrern und Eltern gleichermaßen ausgeübt, nicht erheblich schlimmer ist. Ganz selten wurde die schärfste Form angewandt, bei der der Sünder über die Bank gelegt wurde und die Schläge bei „strammgezogener“ Hose auf das Gesäß erhielt. Zwei meiner Kameraden, Heinz Knipp und Willi Noll, hielten hier den Rekord. Es hat ihnen, denke ich, ebenso wenig geschadet wie der weit größeren Schar derer, die Stockschläge „auf die Finger“, das heißt in die geöffnete Handfläche erhielten. Solches ist mir auch mal widerfahren. Leider ist mir nicht erinnerlich, was ich verbrochen hatte. Aber ich weiß noch, wie weh das tat, und daß ich viel zu stolz war, um mir das anmerken zu lassen. Schmerzen beherrschen zu lernen ist doch auch ein Erziehungserfolg. Eine andere Reaktion zeigte ich jedoch, als Fräulein Hartmann mir einmal im Musikunterricht, sie spielte dann auf ihrer Geige, in einem emotionalen Zornesausbruch den Violinbogen über den Kopf schlug. Ich grinste offen und schadenfroh, als der Bogen zerbrach.
Schreiben lernten wir im ersten Schuljahr auf Schiefertafeln. Ich war stolz, daß ich zu den wenigen gehörte, die holzummantelte Griffel besaßen, in der Art wie Bleistifte. Sie waren weicher, ließen sich leichter über die Tafel führen, ohne dabei zu quietschen, ohne Rillen zu hinterlassen, wie es die harten Schiefergriffel taten. Erst im zweiten Jahr begannen die Versuche mit Feder, Federhalter und Tinte. Letztere befand sich in Tintenfässern, die in die Pulte eingelassen waren. Zu Anfang gab es ein mehr oder weniger großes Geschmiere auf dem Papier und den Händen. Bald entdeckten wir, daß sich mit der Tinte herrliche und vielseitige Schweinereien anstellen liegen. Man konnte Kreidestücke hineinstecken und dem sich bildenden blauen Schaum zusehen. Lustig war es auch, Löschblätter einzufärben, Kugeln daraus zu formen und mit den feuchten Geschossen nach Mitschülern zu werfen. Viel schöner jedoch war das alte Spiel, die Zopf enden der Mädchen blau zu färben.
Zum Schreiben gehörte das Fach Schönschreiben, Es war im Stundenplan und im Zeugnis gesondert aufgeführt. Bei dieser, von mir nicht geschätzten Übung, die angeblich besonderen Wert haben sollte, kam es mir einmal in den Sinn, alle Punkte, wie ich glaubte, besonders schön zu machen, indem ich zunächst einen kleinen Kreis zog und diesen dann ausfüllte. Meine Punkte hatten etwa fünf Millimeter Durchmesser. Ich fand sie schön, nicht nur am Schluß des Satzes, auch über dem i machten sie sich gut. Ich erwartete dafür ein besonderes Lob. Als wir die zensierten Arbeiten ein paar Tage später zurückerhielten, war ich sehr enttäuscht. Meine schönen Punkte waren mit roter Tinte durchgestrichen. Das ärgerte mich mehr, als die schlechte Note für die Schrift. Des von der Lehrerin angefügten Satzes wegen habe ich diese Für mindestens einen Tag gehaßt. Sie hatte geschrieben: „Du sollst schön (!!) schreiben, nicht Pferdeäpfel malen!“
Meine gerade erworbenen Schreibkünste nutzte ich, um meinen ersten Beitrag zur Weltliteratur festzuhalten, Mein Gedicht umfaßte nur zwei Zeilen:
Es war einmal ein grüner Mann,
der hatte siebzig Hosen an.
Nach Ostern 1933 kam meine Schwester Brigitte zur Schule. Nur ein Erlebnis blieb aus dieser Zeit des gemeinsamen Besuches der Horchheimer Volksschule in meinem Gedächtnis. Es war in den ersten Wochen des neuen Schuljahres, als nach Anklopfen und dem „Herein“ von Fräulein Hartmann, meine Schwester in unser Klassenzimmer trat, gleich an der Tür sich ihres Auftrages entledigend. An meine Lehrerin gewandt erklärte sie: „Du sollst mir Bilder geben.“ Gemeint war Anschauungsmaterial für das Fach Biblische Geschichte. Es waren auf Karton aufgezogene Bilder im Stil der Nazarener. Brigittes „Du“ gegenüber der Lehrerin empörte mich so, daß ich ihr zurief: „Sie, das heißt Sie“. Fräulein Hartmann beruhigte mich: „Nun laß sie doch, das ist doch nicht schlimm.“ Brigitte erhielt die Bilder. Im Hinausgehen warf sie mir aus den Augenwinkeln einen triumphierenden Blick zu. Das wiederum ärgerte mich so, daß ich zu Hause sofort erzählte, Brigitte habe Fräulein Hartmann geduzt. Petzen war sonst nicht meine Art, ich wollte mich aber für den vernichtenden Blick rächen, der mir die erste Einsicht in das Waffenarsenal des weiblichen Geschlechtes eröffnet hatte. Aus meiner Rache wurde wegen der elterlichen Reaktion, besser wegen deren Nicht-Reaktion, ebenso wenig, wie aus meinem morgendlichen Erziehungsversuch an meiner Schwester. So etwas nennt man Lebenserfahrung.
Eine völlig anders geartete Erfahrung machte ich mit meiner Nase. Sie war damals sehr empfindlich. Schon recht leichte Berührungen führten zu starkem Nasenbluten. Diesen Umstand nutzte ich mit kindlicher Raffinesse, wann immer ich es für gut hielt. Wußte ich auf eine Frage keine Antwort, hatte ich ein Gedicht oder das Große Einmaleins mit Sechzehn nicht gelernt, so genügte ein unauffälliger kurzer Knuff gegen die Nase, um sie bluten zu lassen, während ich mich vom Platz erhob, wie es üblich war, wenn man vom Lehrer namentlich aufgerufen wurde. Weil ich nun, der Blutung wegen, die Antwort nicht geben konnte, wurde ein anderes Kind aufgerufen. Gab dieses die richtige Antwort, war ihm das nützlich, aber auch mir, denn ich konnte meine Wissenslücke schließen, indem ich genau zuhörte.
Aufgabe der Schule ist es auch, staatsbürgerliches Wissen zu vermitteln. Was geschah auf diesem Gebiet? Da ist mir aus den ersten Jahren das Gedenken an Albert Leo Schlageter erinnerlich. Die Franzosen hatten ihn wegen seines gewaltsamen Kampfes gegen die Verkehrsverbindungen der Ruhrbesatzung und gegen die unerfüllbaren Reparationsforderungen, unter denen das Reich wirtschaftlich auszubluten drohte, zum Tod verurteilt und 1923 auf der Golsheimer Heide bei Düsseldorf erschossen. Ein anderer, damals noch junger Anlaß zu historisch-aktuellem Unterricht war der Waffenstillstandstag, dessen Behandlung in dem Satz „Im Felde unbesiegt“ gipfelte. Es wäre für unsere geschichtliche Bildung sehr hilfreich gewesen, hätte man dieses Ereignis nicht einseitig mit der viel besprochenen Dolchstoßlegende gekoppelt. Warum wurde nicht vermittelt, daß 1918 weder die Entente noch die Mittelmächte bereit und fähig waren, den Krieg auf dem Schlachtfeld zu entscheiden? Warum wurde zwar die im Versailler Vertrag dokumentierte Unfähigkeit der Siegermächte, Frieden zu schaffen, dargestellt, nicht aber die positiven Ansätze von Locarno? Des Geburtstages des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg wurde gedacht, später das Geburtstages des Führers und besonders das Tages der „Machtübernahme“, des 30. Januar 1933.
Von diesem Jahr an kam in der Schule schrittweise eine psychologisch geschickte und daher sehr wirkungsvolle Propaganda zum Zuge. Hier möchte ich besonders die nationalsozialistischen Filme erwähnen, die uns während der Unterrichtszeit im Horchheimer Kino, im Saalbau Ries, selbstverständlich kostenlos, vorgeführt wurden. Ich habe nur von einem den Titel behalten, er hieß „Hitlerjunge Quex“. Wir waren begeistert von dem jungen Helden. Um die außerordentliche Wirkung zu verstehen, ist heute zu bedenken, daß wir, anders als die mit dem Fernsehen aufgewachsene Generation, keinerlei Medienerfahrung hatten, und demzufolge dem Phänomen Film, ganz abgesehen vom Inhalt, völlig unvorbereitet gegenüberstanden. Die enorme psychische Erregung reagierten wir in der Begeisterung für die im Sinn der Propaganda guten Gestalten ab.
Der veröffentlichte Text stammt aus einem privaten Familienalbum (Braubach, 1987) und befindet sich im Bestand der Sammlung der Heimatfreunde Horchheim e. V.
Die im Original genannten Rechteinhaber konnten trotz Recherche nicht ermittelt werden. Die Veröffentlichung erfolgt aus überwiegendem ortsgeschichtlichem Interesse. Hinweise von Rechteinhabern werden gerne entgegengenommen.